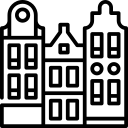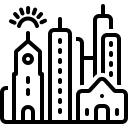Deutschland als führender Standort digitaler Infrastruktur
Der deutsche Immobilienmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, angetrieben durch die dynamische Entwicklung von Rechenzentren. Frankfurt belegt nach London den zweiten Platz in Europa. Die IT-Leistung im Colocation-Segment liegt derzeit bei rund 1,3 GW und soll bis 2029 auf 3,3 GW steigen. In der Region Frankfurt beträgt die operative Leistung etwa 745 MW („live IT load“), im Bau befinden sich 542 MW, und weitere 383 MW sind geplant. Der Wert des deutschen Rechenzentrumsmarktes erreichte 2024 rund 7,71 Milliarden USD, mit einer Prognose von 12,84 Milliarden USD bis 2030 – ein jährliches Wachstum von 8,87 %.
Künstliche Intelligenz treibt die Infrastrukturentwicklung maßgeblich voran. Der Markt für generative KI soll bis 2031 um 560 % wachsen und 16,5 Milliarden USD erreichen. Microsoft investiert 3,2 Milliarden EUR in deutsche Cloud-Regionen, die Schwarz-Gruppe plant milliardenschwere Investitionen, und Amazons Engagement in Frankfurt beläuft sich auf 8,8 Milliarden EUR bis 2026.
Rekordinvestitionen und steigende Grundstückspreise
Die deutsche Wirtschaft investiert Milliarden in die Entwicklung digitaler Infrastruktur. Der jährliche Ausbau von Colocation-Kapazitäten liegt bei rund 2 Milliarden EUR, und die kumulierten Investitionen bis 2029 sollen 24 Milliarden EUR übersteigen. Die Grundstückspreise für Rechenzentren erreichen Rekordwerte: In Frankfurt und Berlin haben sich die Industriegrundstücke seit 2023 verdoppelt. Der stabile Leasingwert pro Megawatt beträgt durchschnittlich 15,5 Millionen EUR, während die Grundstückskosten bei rund 1,1 Millionen EUR pro MW liegen. Frankfurt bleibt der führende Markt mit einer Leerstandsquote unter 5 %, und die Colocation-Preise steigen jährlich um 5–10 %.
Energieeffizienzgesetz erzwingt Wandel
Das deutsche Energieeffizienzgesetz bringt strenge Anforderungen mit sich. Ab Januar 2027 müssen Rechenzentren zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden, und der PUE-Wert neuer Anlagen darf 1,2 nicht überschreiten. Deutsche Rechenzentren verbrauchen jährlich rund 17,9 Milliarden Kilowattstunden, wovon bereits 88 % aus erneuerbaren Quellen stammen.
Der Netzanschluss bleibt ein Engpass: Neue Rechenzentren warten durchschnittlich über sieben Jahre auf die Anbindung. In Brandenburg gingen 170 Anträge mit einer Gesamtleistung von 22 GW ein – bislang wurden nur zwei Anlagen mit jeweils 100 MW ans Netz angeschlossen.
Polen als aufstrebender Wettbewerber in der Region
Der polnische Rechenzentrumsmarkt wächst rasant, angetrieben durch die digitale Transformation. Der Marktwert lag 2024 bei 2,358 Milliarden USD und soll bis 2035 auf 5,41 Milliarden USD steigen – ein jährliches Wachstum von 7,84 %. Die installierte Leistung liegt derzeit unter 200 MW und wird sich bis 2030 auf über 500 MW nahezu verdreifachen.
Warschau ist das zentrale Cluster mit rund 28 Colocation-Standorten, was etwa einem Drittel der nationalen Kapazität entspricht. Microsoft kündigte im Februar 2025 Investitionen von 2,8 Milliarden PLN an, Google investierte über 2 Milliarden USD, und Vantage plant einen Campus mit 64 MW Leistung.
Standortvorteile und Herausforderungen
Polen bietet strategische Standortvorteile: die zentrale Lage im Herzen Europas, die Verbindung zwischen Ost- und Westeuropa und geringere Betriebskosten als in den FLAP-D-Märkten. Das Land gilt als stabile Investitionsinsel, und Kapital aus Westeuropa fließt zunehmend nach Polen.
Die größte Herausforderung bleibt der Netzanschluss. Der Übertragungsnetzbetreiber PSE erhält Anfragen mit einer Gesamtkapazität von 500–1000 MW. Zwischen 2015 und 2021 wurden fast 6.000 Anschlussanträge abgelehnt. PSE plant bis 2034 eine Kapazitätserhöhung um 1.200 MW für Rechenzentren.
Vergleich und Marktentwicklung
Der deutsche Markt ist über dreimal so groß wie der polnische (7,71 Mrd. USD vs. 2,36 Mrd. USD). Polen wächst jedoch deutlich schneller – 15,73 % jährlich gegenüber 8,87 % in Deutschland.
Frankfurt bleibt das zweitgrößte Rechenzentrumscluster Europas und beherbergt mit DE-CIX den größten Internetknoten der Welt. Warschau ist der am schnellsten wachsende Standort in CEE, bündelt ein Drittel der polnischen Kapazitäten und dient als Brücke zwischen West- und Osteuropa.
KI als Wachstumsmotor
Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz erfordert neue Recheninfrastruktur. Die weltweite Nachfrage nach Rechenleistung wird sich bis 2030 verdreifachen. Der deutsche KI-Markt wird bis 2030 auf 8,29 Milliarden USD wachsen, während der polnische Markt jährlich um 35 % zunimmt. KI-Racks erreichen Leistungsdichten von 40–80 kW und erfordern Flüssigkühlung.
Der deutsche Markt soll bis 2030 ein Volumen von 12,84 Milliarden USD und eine installierte Leistung von 3,3 GW (aktuell 1,3 GW) erreichen, was 23 Milliarden EUR zum BIP beiträgt. Der polnische Markt wird bis 2035 5,41 Milliarden USD erreichen und könnte sich als führender Standort für grüne Rechenzentren in CEE etablieren. Warschau wird sich zu einem wichtigen Hub für Workloads aus dem FLAP-D-Raum entwickeln.
Rechenzentren als Wirtschaftsmotor
Die Entwicklung des Rechenzentrumsmarktes in Deutschland hat erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft, insbesondere vor dem Hintergrund des digitalen Strukturwandels. Investitionen – etwa in Frankfurt – ziehen internationale Betreiber an, die langfristige Perspektiven sehen. Dank moderner Infrastruktur und energieeffizienter Kühlsysteme werden Rechenzentren zu einem zentralen Element der digitalen Wirtschaft.
Auch der polnische Markt liefert zunehmend Daten und Impulse. Besonders interessant sind dabei Flächen und Grundstücke, die für Data-Center-Investitionen vorgesehen sind. Analysen von Vantage und JLL zeigen, wie Rechenzentren den Immobilien- und Energiesektor in Mittel- und Osteuropa prägen und zu deren nachhaltiger Entwicklung beitragen.